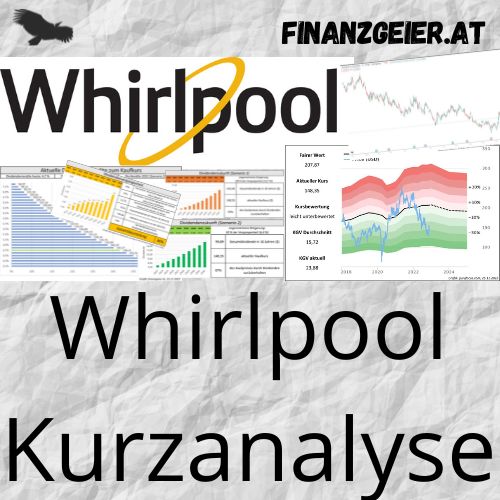Notleidende Kredite und was die OeNB über die Lage verrät
Der österreichische Kreditmarkt steht an einem Wendepunkt: Nach sieben Quartalen Rezession steigen die Risiken rund um Unternehmensinsolvenzen und die Anfälligkeit gewerblicher Immobilien. Hinter nüchternen Statistiken entfalten sich reale Konsequenzen für Banken, Geschäftstreibende und den Wirtschaftsstandort. Was passiert, wenn Zuversicht schwindet und regulatorischer Druck wächst? Wie wirken sich stille Verwundbarkeiten, Polster und neue Regeln im Alltag aus?
Die Kredite leiden – und nicht nur sie
Österreich wirkt auf den ersten Blick stabil. Die Banken melden solide Kapitalpuffer, die Nationalbank tritt ruhig vor die Presse – doch unter dieser Oberfläche arbeitet eine jahrelange Rezession nach. Sieben Quartale wirtschaftlicher Schwäche hinterlassen definitiv Spuren, die jetzt erst sichtbar werden: mehr Firmeninsolvenzen, leere Gewerbeimmobilien, und ein Kreditmarkt, der zu kippen beginnt.
Die Oesterreichische Nationalbank spricht von „notleidenden Krediten“. Ein technischer Begriff – aber dahinter stehen sehr reale Risiken. Besonders im gewerblichen Immobilienbereich ist die Lage angespannt: 7,9 Prozent dieser Kredite gelten inzwischen als gefährdet, mehr als doppelt so viele wie im Durchschnitt des gesamten Kreditmarktes. Das ist kein Randphänomen, sondern ein strukturelles Signal.
OeNB Gouverneur Martin Kocher versucht eine Gratwanderung: Auf der einen Seite betont er die Stabilisierungstendenzen der Konjunktur und die hohe Sparquote als Chance für zukünftigen Konsum. Auf der anderen Seite warnt er vor deutlich steigenden Wertberichtigungen – also höheren Abschreibungen, die die Gewinne und das Eigenkapital der Banken belasten werden.
Was sich hier zeigt, ist ein vertrauter Mechanismus: In langen Aufschwungphasen wachsen Risiken lautlos mit, und erst wenn sich die Wirtschaft abkühlt, treten sie offen zutage. Österreichs Banken haben in den letzten Jahren gute Gewinne erzielt und vieles davon einbehalten. Doch ob dieser Polster reicht, wird sich erst zeigen, wenn die Welle notleidender Kredite ihren Höhepunkt erreicht.
Wer trägt die Krise wirklich?
Wenn die Nationalbank von „notleidenden Krediten“ spricht, wirkt das nüchtern und technisch – als ginge es um abstrakte Buchwerte. Doch diese Kredite stehen für Betriebe, Projekte und Geschäftsmodelle, reale Werte die unter Druck geraten sind. Die Krise manifestiert sich also nicht am Papier, sondern in der realen Wirtschaft: in Unternehmen, die nach Jahren der Schwäche keine Reserven mehr haben; in Gewerbeimmobilien, deren Mieter ausgefallen sind; in Finanzierungsmodellen, die nur in Zeiten stetigen Wachstums funktionieren konnten.
Bemerkenswert ist, wie sich die Gewichtung verschoben hat. Während private Wohnbaukredite weitgehend stabil bleiben – mit einer Ausfallsquote von rund einem Prozent, konzentrieren sich die Probleme im gewerblichen Bereich. Das legt offen, wo die Verwundbarkeit des Systems am größten ist: bei Projekten, die auf hohe Auslastung, konstante Nachfrage und steigende Immobilienwerte angewiesen sind.
Die OeNB formuliert ihre Warnungen vorsichtig, aber eindeutig: strengere Anforderungen, höhere Risikovorsorge, mehr Kapitaldisziplin. Doch diese Maßnahmen zeigen, wer die Last trägt. Die Wirtschaft schwächelt, Investitionen bleiben aus – und genau in dieser Phase steigt der regulatorische Druck.
Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob die Risiken real sind. Sie lautet: In welchem Teil des Systems werden sie sichtbar – und wer muss sie in den kommenden Jahren schultern?
Vom Boom zur stillen Verwundbarkeit
Die aktuelle Lage ist kein plötzlicher Schock, sondern das Ergebnis eines langen Zyklus. Über Jahre hinweg haben niedrige Zinsen und hohe Immobilienbewertungen den Kreditmarkt befeuert. Projekte ließen sich leicht finanzieren, Geschäftsmodelle schienen belastbar, und die Risiken wirkten beherrschbar – zumindest solange die Rahmenbedingungen stabil blieben.
Doch als die Konjunktur ab 2022 an Schwung verlor, zeigte sich, wie abhängig viele gewerbliche Finanzierungen von einem stetigen Aufwärtslauf gewesen waren. Eine Rezession über sieben Quartale ist kein Betriebsunfall, sondern ein struktureller Bremsklotz. Unternehmen verloren Aufträge, Mietflächen blieben leer, und jene Projekte, die mit engen Kalkulationen gestartet waren, rutschten zuerst ins Risiko.
Die Nationalbank verweist darauf, dass der Gesamtanteil notleidender Kredite zwar bei etwa drei Prozent stagniert – doch dieser Durchschnitt verschleiert die Ungleichverteilung. Der gewerbliche Immobiliensektor weist eine Gefährdungsrate von 7,9 Prozent auf. Hier verdichtet sich alles, was in den Jahren davor unbemerkt gewachsen ist: hohe Verschuldung, unsichere Nachfrage, teils optimistische Annahmen über Marktwert und Verwertbarkeit.
Mit neuen europäischen Vorschriften steigt nun der Druck, diese Risiken sichtbar zu machen und bilanziell abzubilden. Das bedeutet höhere Wertberichtigungen – also Abschreibungen –, die in die Bücher der Banken wandern. Ein Schritt, der notwendig ist, aber gleichzeitig offenlegt, wie weit die stille Verwundbarkeit schon fortgeschritten ist.
Ein stabiler Sektor unter zunehmendem Druck
Offiziell präsentiert sich der österreichische Bankensektor in guter Verfassung. Die Institute sind gut kapitalisiert, teils besser als vor früheren Krisen, und verfügen über hohe Gewinnrücklagen aus den vergangenen Jahren. Diese Polster sollen nun helfen, die Belastungen aus steigenden Wertberichtigungen abzufedern. Doch Stabilität ist nicht dasselbe wie Entspannung – und schon gar nicht wie Aufschwung.
Denn während die Banken solide wirken, bleibt die wirtschaftliche Realität gedämpft. Die Kreditnachfrage der Unternehmen ist nach wie vor schwach. Viele Betriebe vermeiden neue Verbindlichkeiten, weil Aufträge fehlen oder Margen einbrechen. Lediglich im privaten Wohnbau zeigt sich eine leichte Erholung, und selbst dort liegt die Ausfallsquote mit rund einem Prozent deutlich unter dem gewerblichen Risiko.
Gleichzeitig rücken strengere europäische Regeln in greifbare Nähe. Die OeNB empfiehlt den Instituten, ihre Kapitalbasis zu sichern, Ausschüttungen zurückzunehmen und ihre Kostenstrukturen zu straffen. Auch Investitionen in Digitalisierung und Cybersicherheit werden betont – nicht als Zukunftsvision, sondern als notwendige Vorbereitung auf eine Phase höherer regulatorischer Anforderungen.
Der Druck aus zwei Richtungen – schwache Realwirtschaft und härtere Aufsicht – formt ein zerbrechliches Gleichgewicht. Noch halten die Polster, noch lassen sich Risiken verteilen. Doch die zentrale Frage bleibt: Wie robust ist ein System, dessen Stabilität vor allem aus der Vergangenheit stammt, während die Gegenwart neue Risiken erzeugt?
Wenn Stabilität nicht gleich Erholung bedeutet
Am Ende dieses Bildes steht eine widersprüchliche Situation: Ein Bankensektor, der offiziell robust ist – und eine Wirtschaft, die davon kaum profitieren kann. Die Österreichische Nationalbank spricht von Kapitalpuffern, soliden Strukturen und einer hohen Sparquote als potenzieller Chance. Doch diese Sparquote ist selbst ein Symptom der Unsicherheit: Wer vorsichtig ist, konsumiert nicht. Und ohne Konsum entsteht kein Wachstum, das neue Investitionen anregen könnte.
Die OeNB hofft auf eine Stimmungsaufhellung, die das zurückgehaltene Geld wieder in den Wirtschaftskreislauf lenkt. Doch sieben Quartale Rezession haben Spuren hinterlassen, und viele Branchen arbeiten noch immer mit angezogener Handbremse. Firmen, die früher investieren wollten, warten ab. Gewerbeobjekte, die einst Wachstum signalisierten, stehen nun für Risiken im Ausmaß von Milliarden.
Die angekündigten Wertberichtigungen sind deshalb mehr als nur technische Korrekturen in Bankbilanzen. Sie stehen für einen sich aufteilenden Weg: Entweder bleibt die Belastung allein im Bankensektor – oder sie wird zum Katalysator für noch größere Zurückhaltung.
Österreichs Wirtschaft steht damit vor einer klassischen Übergangsphase. Das System wirkt stabil, aber nicht kraftvoll. Die Risiken sind eingepreist, aber nicht überwunden. Und die Frage, die sich stellt, ist weniger dramatisch als grundlegend: Reicht Stabilität allein aus, um eine echte Erholung einzuleiten – oder braucht es mehr als Polster, Quoten und Warnungen, um den Stillstand zu durchbrechen?